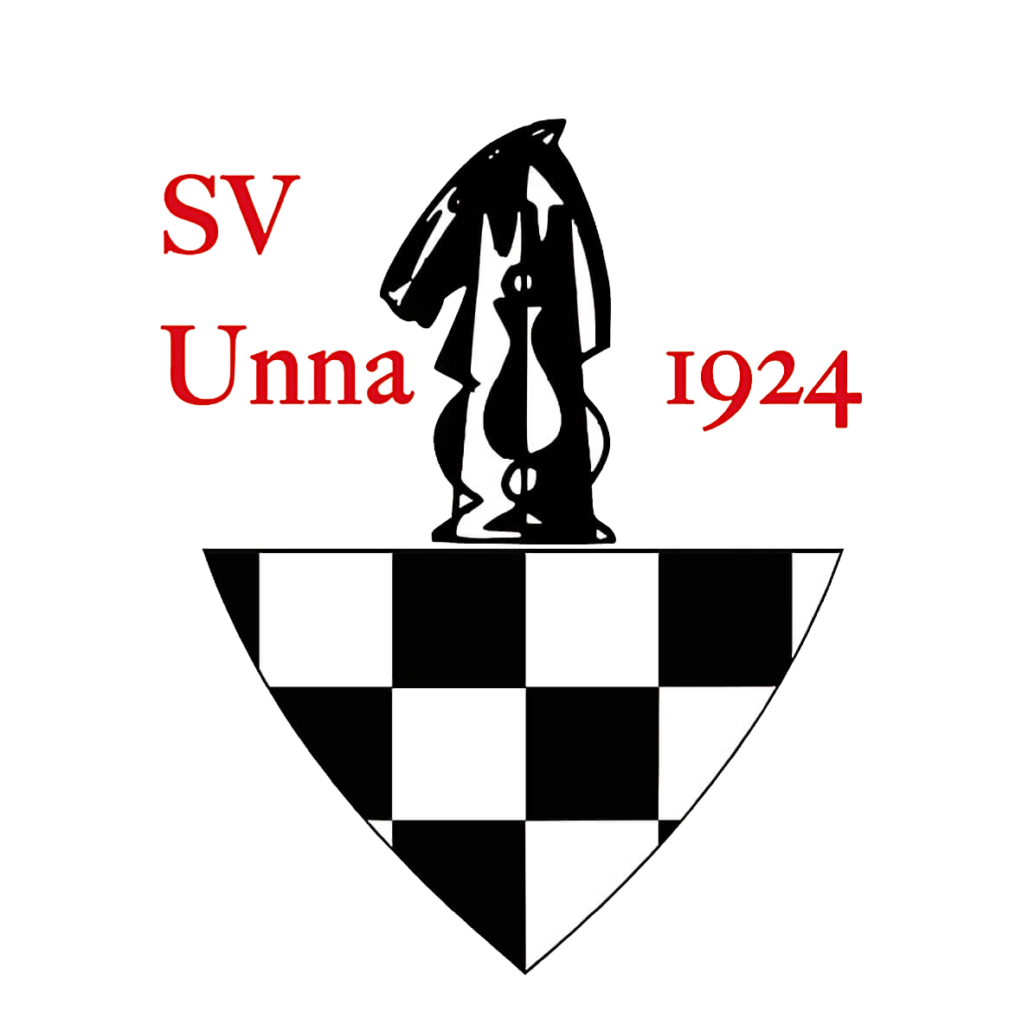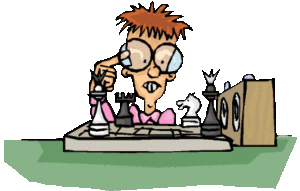Schon einige Mitglieder früherer Jahre haben uns die Freude gemacht, im Rahmen unseres diesjährigen Jubiläums ihre besonderen Erinnerungen preiszugeben. Heute ist es Ulli Hesse, mit dem wir unsere Reihe von Ehemaligen-Berichten fortsetzen und sagen hierfür ein herzliches Dankeschön!
„Der Höhepunkt meiner Zeit als Einzelspieler beim SV Unna war der Moment, als der Schnurrbart von Vlastimil Hort zu zittern begann. Der berühmte Großmeister, damals einer der zwanzig besten Spieler der Welt, war schon seit einigen Minuten vertieft in die Stellung auf dem Brett zwischen uns, als plötzlich seine Gesichtsbehaarung vibrierte. Da wusste ich, dass ich mit meiner Vermutung recht hatte. Zwar stand der Tscheche nicht direkt auf Verlust, aber wenn einer von uns beiden diese Partie gewinnen konnte, dann war es ganz sicher nicht er. Mit einem Mal wurde mir ganz heiß. Ich blickte mich verstohlen in den Räumen der Volksbank am Nordring um und sah, wie immer mehr Leute zu uns hinüberkamen, um sich das Spiel anzusehen. Der pickelige Junge im Parka hielt mit dem Gewinner der Dortmunder Schachtage mit! Und dabei war es noch gar nicht so lange her, dass man mich beim SV Unna weggeschickt hatte …
Zugegeben, das ist jetzt etwas reißerisch formuliert. Aber als ich an einem Herbstabend des Jahres 1980 zum ersten Mal die Vereinsräume betreten hatte, waren die anwesenden Spieler über mein Erscheinen in erster Linie verwundert gewesen. Zu jener Zeit trainierte der Klub noch nicht im Schalander der Lindenbrauerei, sondern im heute abgerissenen Kolpinghaus in der Klosterstraße. Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen und erklärte den Anwesenden, dass ich jemanden suchte, mit dem ich Schach spielen könnte. Mein deutlich älterer Bruder, der mir das Spiel etwas mehr als zwei Jahre zuvor beigebracht hatte, war wenig erpicht darauf, sich dauernd besiegen zu lassen, und der Schachcomputer, den meine Eltern mir zu Weihnachten geschenkt hatten, wurde zwar von Weltmeister Anatoli Karpow beworben, langweilte mich aber. Da fragte mich einer der Spieler, wie alt ich sei. „Vierzehn“, gab ich wahrheitsgemäß zurück. Lächelnd erklärte das Vereinsmitglied, mein Anliegen sei zwar sehr lobenswert, aber ich hätte wohl die in der Zeitung abgedruckten Trainingszeiten nicht richtig gelesen, denn dies sei der Vereinsabend der Erwachsenen, ich dagegen wäre besser in den Räumen der Katharinen-Schule aufgehoben, wo sich an jedem Donnerstagnachmittag jemand namens Günter Abromeit um die jüngeren Spieler kümmere. Mit hochrotem Kopf verließ ich den Saal und ging im Dunkeln zurück nach Hause.

Niemandem, der diese Zeilen liest, muss ich erklären, dass Günter – ich kann mich nicht erinnern, dass er jemals mit „Herr Abromeit“ angesprochen wurde – auch deshalb der geborene Jugendtrainer war, weil man sich bei ihm sofort gut aufgehoben fühlte. Aber vielleicht sollte mal jemand ausdrücklich erwähnen, dass auch die anderen Spieler einen Neuling mit offenen Armen empfingen. Das ist in Sportvereinen nicht unbedingt üblich, so hatte ich einige Jahre vorher die Lust am Fußball bei Rot-Weiß Unna schnell verloren, weil die meisten meiner Mitspieler schroff, abweisend und erheblich hochnäsiger waren, als es ihren Fähigkeiten am Ball entsprochen hätte. Doch mit den Schachspielern beim SV Unna verstand ich mich auf Anhieb gut, Torsten Lutz und Peter Roth wurden sogar rasch zu engen Freunden. (Torsten Fuest, der heute für den SV Bönen spielt, war auch ein guter Freund von mir, dazu noch ein Nachbar, aber in meiner Erinnerung war er damals noch nicht im Verein, sondern kam erst durch mich zum Schach.)
Wahrscheinlich half es mir bei der Aufnahme ins Vereinsleben, dass ich kein kompletter Patzer war. Bei meiner ersten Stadtmeisterschaft holte ich ein Remis gegen Volkmar Golek, den mit Abstand besten Spieler im Jugendbereich, und bis zu ihrem Tod behauptete meine Mutter steif und fest, ich wäre nach dem Turnier in einer Lokalzeitung als „neuer Stern am Unnaer Schachhimmel“ bezeichnet worden. Noch in meiner ersten Saison wurde ich sogar kurzfristig gebeten, in der ersten Mannschaft auszuhelfen. Wir bestiegen einen Kleinbus und dann fuhren uns zwei ältere Spieler, möglicherweise Jens Lütke als Fahrer und Udo Seepe als Beifahrer, ins Rheinland, vielleicht nach Porz. Ich spielte wieder remis, und wir waren erst spät am Abend wieder in Unna.
Ohne meine Eltern war ich noch nie so weit weg von zu Hause gewesen, aber es machte mir überhaupt nichts aus, im Gegenteil: Es war aufregend und lustig. Kaum zwei Jahre vorher hatte ich bei einem Schulaufenthalt in Föckinghausen noch mit üblem Heimweh zu kämpfen gehabt, nun fuhr ich mit Günter und anderen Spielern bis an den Edersee, wo wir ein Turnier abhielten, bei dem jede Partie mit der Pirc-Verteidigung zu beginnen hatte. Lange habe ich gedacht, diese Schachfreizeit hätte nur ein Wochenende umfasst, doch inzwischen weiß ich, dass wir ganze drei Wochen dort in Hessen waren. Die Zeit muss für mich wie im Flug vergangen sein. Ja, natürlich war ich inzwischen älter geworden, aber es war auch der Zusammenhalt in der Gruppe und die ganz besonderen Fähigkeiten von Günter, die dazu führten, dass ich mich tief in der Fremde wie zu Hause fühlte.
Nicht, dass jemand das mit dem „Stern am Schachhimmel“ falsch versteht: Ich kann mein Können heute ziemlich gut einschätzen, und mein Fall ist wahrscheinlich absolut typisch für junge Schachspieler. Um es in einem Satz zusammenzufassen: Ich wurde sehr schnell recht gut – und dann einfach nicht mehr besser. Ich gewann zweimal die Schulmeisterschaft des Geschwister-Scholl-Gymnasiums (obwohl noch andere Vereinsspieler in der dortigen Schach-AG waren) und gehörte zum Team des SV Unna, das die NRW-Liga hielt. Aber als ich dann vom Jugendbereich zu den Senioren wechselte, hätte ich mein Niveau anheben müssen – und konnte es nicht. Zum einen lag das an völlig typischen Fehlern. So lernte ich Eröffnungen, indem ich mir nur die Züge merkte, ohne die positionellen Überlegungen dahinter zu verstehen. Endspiele waren für mich ein Buch mit sieben Siegeln, was bis dahin nie ein Problem gewesen war, weil ich in der Jugend dank meiner taktischen Fähigkeiten die Spiele meistens schon vorher entschieden hatte. Ich hätte also härter an mir und an meinem Schachspiel arbeiten müssen, und zwei, drei Jahre vorher hätte ich das wahrscheinlich auch getan, aber Mitte des Jahrzehnts war Schach einfach nicht mehr mein Lebensmittelpunkt.
Damals nahmen – neben den Spielen von Borussia Dortmund – Musik und Konzerte einen immer größeren Raum in meinem Leben ein. Heute erinnere ich mich mit ziemlichem Unbehagen an den Sonntag, als ich ungewaschen, verkatert und in einer schwarzen Lederjacke, auf die ich mit weißem Edding die Namen von Punkbands gekritzelt hatte, irgendwo in Herringen oder Wiescherhöfen oder Stockum einem älteren Herrn gegenübersaß, der mich verschreckt anblickte. Dabei wollte ich ihn gar nicht provozieren, sondern einfach nur meiner Mannschaft helfen, so gut ich noch konnte. Schließlich fühlte ich mich dem SVU weiterhin eng verbunden, weshalb ich auch bis weit in die Neunziger noch Mitglied blieb, damit der Klub wenigstens meine Beiträge bekam.
Selbst am Brett sitzen konnte ich allerdings immer seltener, nachdem ich Ende 1985 meinen Zivildienst begonnen hatte. Ich zog nach Dortmund, fing anschließend ein Studium in Bochum an und wurde im Sommer 1990 auch noch Vater. Wir lebten in Witten, später an der Ostsee, irgendwann in Berlin. Was mich bei jedem Umzug begleitete, waren ein Schachbrett und meine geliebten Staunton-Figuren aus Plastik (nicht die kleinen aus Holz, die mochte ich nie). Nicht, dass ich jemals damit spielte, aber ich wollte eine Erinnerung an meine sehr schönen Jahre beim SV Unna behalten. Und zwischendurch googelte ich immer mal wieder Namen aus meiner Vergangenheit, so erfuhr ich auch mitten in der Corona-Zeit, dass Günter gestorben war. Obwohl ich ihn seit gut dreißig Jahren nicht gesehen hatte, traf mich die Nachricht, als hätte ich einen engen Verwandten verloren.
Auch wenn niemand diesen Satz mehr hören kann: Die Pandemie hatte auch ihr Gutes. Ich zum Beispiel vertiefte mich wieder ins Schachspiel, weil ich mit wachsender Begeisterung die Online-Turnierserie verfolgte, die Magnus Carlsen ins Leben gerufen hat. Einerseits ist es heute ein ganz anderes Spiel, als ich es kannte: schnell, actionreich, super-aggressiv und gespielt von verblüffend jungen Leuten. Andererseits ist es noch immer das Spiel von Ruy López und Bobby Fischer und Günter Abromeit, und wann immer ich eine besonders spektakuläre Partie sehe, denke ich zurück an den 6. März 1983. Das Datum habe ich mir merken können, weil es der Tag einer bedeutenden Bundestagswahl war. An jenem Sonntag hatten wir ein Auswärtsspiel in Herringen oder Wiescherhöfen oder Stockum und traten nur mit fünf Spielern an. Ihr ahnt schon, was passierte: Der SV Unna gewann 5:3. Es war unser „Miracle on Ice“, unser Wunder von Bern.
Womit wir wieder bei Vlastimil Hort wären. Der zuckte nämlich noch ein wenig mit seinem Bart, dann streckte er mir abrupt die Hand ins Gesicht und rief: „Rrremisss!“ Etwas verdattert schlug ich ein, woraufhin er sofort zum nächsten Brett eilte. Die Umstehenden beglückwünschten mich, schließlich hatte Hort die meisten Partien bei dieser Simultanvorstellung souverän gewonnen. Aber ich war mir nicht sicher, ob ich mich wirklich freuen sollte. Zum einen hatte ich die Stellung bloß von einem anderen Spieler übernommen, der nach der Eröffnung zu einem Termin musste, vermutlich Jens Lütke. Zum anderen war ich mir nicht sicher, ob der alte Fuchs Hort mich vielleicht überrumpelt hatte. Schachspieler, das wisst ihr alle, haben viele Tricks auf Lager. Die nachfolgenden Analysen blieben jedenfalls ohne eindeutiges Ergebnis. Ja, meine Stellung war gut, aber wie gut wirklich? Man könnte sagen, das Remis gegen Hort war sinnbildlich für meine Karriere im SV Unna: Es war sehr schön und ganz sicher auch ein Erfolg, aber vielleicht wäre mehr drin gewesen.